step fortbildung
step fortbildung beinhaltet eine Weiterbildung im Baukastenprinzip, die die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch Sport in den Vordergrund rückt. In unseren Workshops gehen wir auf Potenziale und Herausforderungen bei der Arbeit mit vielfältigen (Sport-)Gruppen ein und erarbeiten gemeinsam Handlungsansätze. Teilnehmer*innen erwerben neue Fähigkeiten und Kenntnisse, verbessern ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und lernen Integration und Vielfalt im und durch Sport zu fördern.
Ziel der Weiterbildung ist es, Multiplikator*innen auszubilden. Über die Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns übertragen diese ihr Wissen in die Sportpraxis mit Kindern und Jugendlichen. Sie schaffen Orte der Toleranz, an denen Integration und Vielfalt gelebt wird.
Erreichte
Multiplikator*innen
0
Durchgeführte Workshops
0
Seit 2018
Bundesweit
Digital möglich
Multiplikator*innen-Effekt: 1:10
Erreichte
Multiplikator*innen
0
Durchgeführte Workshops
0
Seit 2018
Bundesweit
Digital möglich
Multiplikator*innen-Effekt: 1:10
Für wen?
Die Workshops richten sich an Organisationen, die Sport- und Bewegungsangebote nutzen möchten, um soziale Herausforderungen anzugehen und zu bewältigen. Sie fühlen sich angesprochen und möchten Ihre Mitarbeiter*innen oder ehrenamtlich tätige Personen in Ihrer Organisation zu Sportcoaches für Integration und Vielfalt weiterbilden?
Inhalte
Die nachfolgende Broschüre zur Weiterbildung zum Sportcoach für Integration und Vielfalt bietet eine detaillierte Übersicht über unsere Workshops, die von erfahrenen Referent*innen geleitet werden. Darin enthalten sind die Ziele und Inhalte der Workshops, sowie die Methoden und verschiedenen Modi. Außerdem finden sich Preisinformationen und inspirierende Erfahrungsberichte von bisherigen Teilnehmer*innen und Auftraggeber*innen.
Workshops
Die Inhalte der Weiterbildung sind wissenschaftlich fundiert und wurden vom Arbeitsbereich Sportpädagogik des Instituts für Sport und Sportwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der step stiftung entwickelt und stetig angepasst.
Trauma und Sport
Entwickle ein Verständnis für die Auswirkungen von Traumata auf den Körper und lerne, wie Sport als positive Ressource genutzt werden kann, um die körperlichen Symptome von Traumatisierungen zu lindern.
Geschlechtergerechtigkeit im Sport
Sensibilisiere Dich für geschlechtsbezogene Ungleichheiten im Sport und strebe einen Sport jenseits von Geschlechterklischees und Sexismen an. Gemeinsam entwickeln wir Handlungsansätze für eine geschlechtersensible Sportpraxis, die Räume für alle Geschlechter erweitern.
Wertebildung im Sport
Lerne, wie Du Werte wie Respekt, Toleranz und Vertrauen in Deinen Trainingsalltag integrieren kannst. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Werten im Sport zu schaffen und praktische Methoden ihrer Vermittlung zu erlernen.
Sport und Fremdheit
Schärfe Dein Bewusstsein für die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Begegnung mit "Fremdheit" im Sport ergeben. Lerne, Dein eigenes Verhalten zu reflektieren, das Fremdheit erzeugen kann, und entwickle effektive Strategien, um kulturelle Vielfalt im Sport zu fördern und interkulturelles Lernen zu unterstützen.
Geschlechtliche Vielfalt im Sport
Trotz wachsender Sichtbarkeit geschlechtlicher Vielfalt, fällt es trans*, inter*, nicht-binären und agender Personen oft schwer, diskriminierungsfrei am Sport teilzuhaben. Lerne Werkzeuge kennen, um zweigeschlechtliche Barrieren abzubauen und geschlechtliche Vielfalt aktiv in Deiner Sportgruppe zu fördern.
Reflexionskompetenz im Sport
Du wirst zu einem "Reflective Practitioner" ausgebildet. Lerne durch Deine reflexive Haltung Denk- und Reflexionsanlässe in Deiner Sportgruppe zu schaffen, um deren Entwicklung zu kritisch-reflexiven Individuen zu fördern.
Gruppenpreise
Weiterbildung Sportcoach für Integration und Vielfalt
-
Kurz-Workshop (3h) | 375,- € (555,- €¹)
-
Tages-Workshop (6h) | 750,- € (1.110,- €¹)
-
Kompaktformat (18h) | 2.250,- € (3.330,- €¹)
¹ bei zwei Referent*innen und mehr als 15 angemeldeten Teilnehmer*innen
Referent*innen

Pia-Lena Drescher
M. A. Bildungswissenschaften i. A.
Sport und Fremdheit | Reflexionskompetenzen

Ayla Fedorchenko
StEx. Lehramt (Sport, Englisch, Philosophie) | Forschungsprojekt "Gender 3.0" - Uni Flensburg
Sport und Geschlecht

Philipp Stieber
M. Ed. Sport
Wertebildung im Sport

Louisa Ramsaier
B. A. Bildungswiss. | B. Sc. Sportwiss.| M. Sc. Prävention & Gesundheitspsychologie i. A.
Reflexionskompetenzen | Trauma und Sport

Barbara Mayer
Psychol. Psychotherapeutin
Trauma und Sport

Alice Rickert
M. Sc. Psychologie | Doktorandin Universität St. Gallen
Trauma und Sport

Julian Bäuerle
M. Sc. Psychologie | Psychol. Psychotherapeut i. A.
Trauma und Sport

Enno Link
M. A. Interdisziplinäre Anthropologie i. A.
Sport und Fremdheit | Sport und Geschlecht
Sport ist nicht per sé inklusiv – es braucht eine bewusste Ausrichtung auf Werte und die Reflexion der eigenen Perspektiven. Das haben die Teilnehmenden im Workshop mit viel Elan geübt und gemeinsam tolle und kreative Spielideen für die Wertebildung in der Praxis erarbeitet.

Philipp Stieber
Referent für Wertebildung im Sport
Die Teilnehmer*innen lernen ihr eigenes Denken, Handeln oder Nicht-Handeln kontinuierlich zu hinterfragen und ihre persönlichen Erlebnisse systematisch zu analysieren und einzuordnen. Jede*r von uns nimmt Situationen durch die Linse eigener biografischer Erfahrungen wahr. In diesem Workshop entdecken wir die Vielschichtigkeit dieser individuellen Perspektiven.

Louisa Ramsaier
Referentin für Reflexionskompetenzen im Sport
Die Bildungsangebote der step stiftung zeichnen sich durch ein tiefgreifendes Verständnis für die sozialen Themenbereiche im Sport aus. Durch ihre Expertise schaffen es die Referent*innen komplexe Themen verständlich und praxisnah weiterzuvermitteln. Dadurch können wir gemeinsam mehr Sensibilität und ein stärkeres Bewusstsein für die sozialen Fragen im Sport schaffen.

Oliver Kalb
Abteilungsleiter Gesellschaftspolitik Landessportbund Rheinland-Pfalz
Auf der Suche nach einem Anbieter zur Schulung für unsere Honorartrainer*innen haben wir in der step stiftung eine hervorragende Partnerin gefunden. Gerade die Themen zu Trauma, Fremdheit und Geschlechtergerechtigkeit und Sport sind für uns von großer Relevanz in der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Anna Winkler
Projektkoordination GIRLS HUB Safe Hub Berlin
Die Integration von Inhalten aus step fortbildung in die Lizenzverlängerung beim Südbadischen Fußballverband stößt eine nachhaltige Entwicklung und Veränderung in der Qualifizierung von Trainerinnen und Trainern in unseren Vereinen an. Die Vermittlung von Werten und die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sind geschickt in fußballspezifische Übungen verpackt und werden den Teilnehmenden praxisnah an die Hand gegeben und im Trainingsalltag angewendet und etabliert.

Johannes Restle
Geschäftsführer Südbadischer Fußballverband
Die step stiftung bietet gewinnbringende Workshops für den Breitensport, wo das soziale Kapital mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Die Verknüpfung aktueller und relevanter Themen der Sportsozialarbeit sind auf die Bedürfnisse des*r Auftraggeber*in perfekt zugeschnitten und stehen spürbar im Mittelpunkt.

Patrick Orf
Programmmitarbeiter Integration durch Sport, Badischer Sportbund Nord e.V.
Im Rahmen des DKJS-Programms ‚Willkommen im Fußball‘ war uns die step stiftung sowohl als lokale Bündnispartnerin wie auch als Workshopanbieterin stets eine zuverlässige und innovative Partnerin. Die Formate decken aktuelle und relevante Themenbereiche wie z.B. Gender, Konfliktbewältigung oder Spracherwerb im und durch Sport kompetent ab. Zudem gehen die Angebote gezielt auf die unterschiedlichen Zielgruppen ein und entfachen angeregte Diskussionen unter den Teilnehmenden.

Jan Welle
Programmmitarbeiter „Deutsche Kinder- und Jugendstiftung“
Auftraggeber*innen (u. a.):


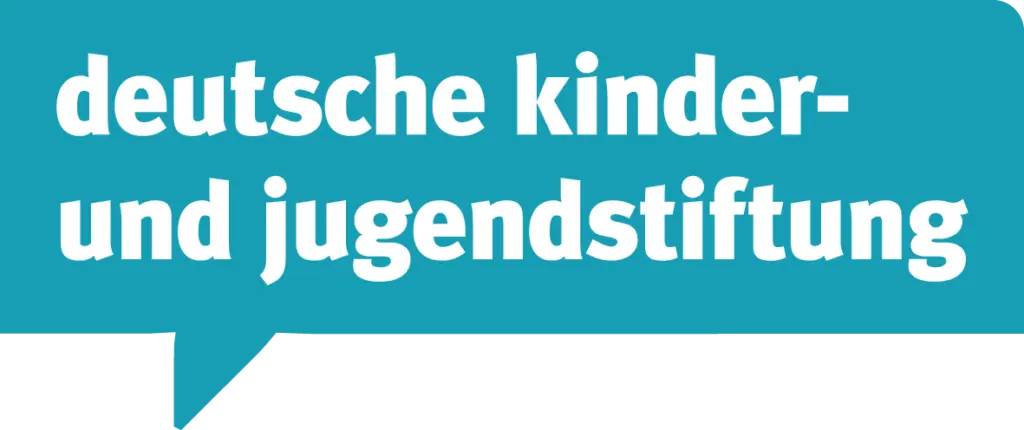



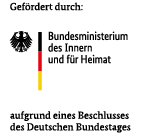
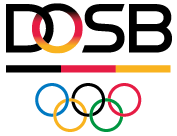


Unterstützer*innen:





